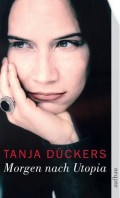Essays
Aufbau Verlag, Berlin 2007
Leseprobe
Klappentext
Provokativ, scharfzüngig, engagiert
Mit Verve und der Lust am Disput beteiligt sich Tanja Dückers an aktuellen Debatten. Ihre Beiträge zur NS-Zeit und ihren Folgen, zu Problemen der osteuropäischen Nachbarn oder den USA widerlegen das Klischee der unpolitischen Generation. In ihren Reportagen beweist sich der besondere Blick für ungewöhnliche Schicksale, Orte und Perspektiven.
„Man muß Tanja Dückers fernab aller literarischen Moden als eine der wichtigsten Autorinnen ihrer Generation ansehen.“ Hamburger Abendblatt
Gegen die Parteinahme
Unter dem pseudo-agitatorischen Titel »Raus aus der Routine – Warum ich Wahlkampf mache« beklagte sich die ansonsten von mir geschätzte Autorin Eva Menasse in der Süddeutschen Zeitung über die allerorts laut gewordene Kritik an der Literaten-Parteinahme für die SPD. Mißmutig konstatiert sie die »gelangweilte Routine«, mit der in den Feuilletons die Frage gestellt wird: »Sind die Intellektuellen politisch genug?« Auch beschwert sie sich, daß kaum ein Autor seine Absage an Günter Grass’ Bitte um Wahlkampfunterstützung für die SPD richtungspolitisch begründet hätte, sondern stets mit einer grundsätzlichen Ablehnung von Parteienbewerbung durch Schriftsteller.
Nun, es wird Zeit, daß jemand ebenso mißmutig konstatiert, wie unendlich langweilig es ist, wenn junge Schriftsteller keine eigene politische Vision aus sich selbst oder ihrer Generation heraus entwickeln können und unter »politischem Engagement« verstehen, einer alteingesessenen Partei, die biedere Realpolitik verkörpert, zu folgen.
Und noch etwas: Schriftsteller sind allemal berechtigt, der aktiven Teilhabe am Wahlkampf grundsätzlich abzuschwören.
Wenn man bedenkt, wie mühevoll in früheren Jahrhunderten die Emanzipation der Kunst von der Religion gewesen ist (wie revolutionär war die Florentiner Renaissance mit der Entwicklung der Zentralperspektive, die den Menschen und nicht Gott ins Zentrum der Anschauung rückte!), wenn man bedenkt, daß auch die versuchte Verpflichtung der Literatur auf Propagandazwecke in diesem Land erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit – 1945 bzw. 1989 – überwunden wurde, nimmt es schon wunder, wie leichtfertig Schriftsteller heute bereit sind, sich einer Partei anzudienen. Sie geben den Posten des neutralen Beobachters auf, obwohl sie doch auf ihrem ureigenen Feld, der Literatur, sehr gut politische Inhalte verhandeln können – kaum ein Werk von Weltrang, das nicht gleichsam von innen heraus ein gesellschaftspolitisches Portrait liefert. Allemal eignet sich in Zeiten diffus gewordener Feindbilder und einer »neuen Unübersichtlichkeit« ein komplexer Roman besser zur Kritik der Verhältnisse als ein »Diskussionsbeitrag« oder eine geraffte Stellungnahme auf einem Forum. Sich unisono einer Partei zur Verfügung zu stellen, bedeutet Ja-Sagen zu zig Positionen, denen man – für sich betrachtet – oft nicht zustimmen würde, das hat mit Unabhängigkeit des Urteils nichts mehr zu tun. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch von einer Partei gebeten worden, Wahlkampf für sie zu betreiben – einer Partei, der ich vermutlich meine Stimme geben werde. Ich habe dennoch abgelehnt. Nicht, weil ich unpolitisch bin, sondern gerade, weil ich politisch bin. Unter »politisch sein« verstehe ich bei einem Intellektuellen: politisch unabhängig sein.
Daß ältere Schriftsteller und Publizisten, die sich seit Jahrzehnten mit einer Partei identifizieren, sich diesem Engagement weiterhin verschreiben (G. Grass, J. Strasser), ist für mich dennoch nachvollziehbar. Rot-Grün ist für die Älteren ihr Generationsprojekt, sie haben es mitaufgebaut, mitgestaltet. Die älteren SPD-Unterstützer waren zumindest als Jüngere Dissidenten; vom oppositionellen Rand der Gesellschaft sind sie an ihre Spitze gerückt. Solche Gentrifizierungsprozesse sind ubiquitär und diskreditieren ein Projekt nicht – schon gar nicht in Retrospektive. Einem Willy Brandt haftete wirklich etwas Visionäres an, als er seine damals sehr umstrittene Ostpolitik einleitete, und die Grünen waren erst recht neu, anders, unkonventionell – politische Avantgarde. Doch die Jungschriftsteller, die sich nun für die SPD haben anwerben lassen, scheinen keine eigenen Visionen mehr zu haben. Nicht mal ein Hauch von Aufbegehren, von der Aufbruchsstimmung, die die Leute früher in Scharen zu den Roten oder den Grünen trieb, hängt in der Luft. Kosovo-Krieg, Hartz IV, Sozialabbau – sie machen mit. Schriftsteller für Hartz IV! – das ist die junge Revolte von heute. Avantgarde? Was ist das? Die Schriftsteller brauchen und sollten nicht den Realpolitikern nach dem Mund reden! Man erhofft sich doch von ihnen ein Vorstellungsvermögen von einer anderen, besseren Zukunft – ein utopisches Moment, ein visionäres Buch. Wenn Literatur sich mit Politik beschäftigt, sollte sie nicht den Status quo bestätigen (dafür sind die Realpolitiker da), sondern den schlechten Ist-Zustand mit dem vergleichen, was möglich wäre. Gute Literatur verhält sich in diesem Sinne wie gute Musik: Sie transzendiert die Realität und vermittelt für einen Moment die Aussicht auf ein besseres Leben. In den Initiativen für Brandt oder die Grünen flackerte zumindest solch eine Hoffnung auf. Welche Utopie in der Unterstützung für Hartz IV liegen soll, ist hingegen völlig schleierhaft. Die Jungen haben sich nun von jemandem, der ihr Großvater sein könnte, und von seinem Weltbild vereinnahmen lassen, das spricht nicht gegen Grass, sondern gegen sie: so konservativ waren junge Schriftsteller noch nie. Anstatt wenigstens jenseits des etablierten Parteienapparats aktiv zu werden, setzt man sich lieber bequem auf den alten Gaul der Vor(vor)-Generation. Da winkt genug Medienaufmerksamkeit, und man hat nicht die Mühe, selber etwas auf die Beine stellen zu müssen. Es ist deutlich: Da stehen nicht Visionäre, sondern Pragmatiker in der Reihe. Oder vielmehr: in Reih und Glied.
Die Lieblingsfrage der Leser
Wenn man viele Lesungen hält, kommt man irgendwann nicht umhin festzustellen, daß es gewisse Fragen gibt, die sich im Anschluß an den eigenen Vortrag wiederholen. Nach meiner immerhin über ein Jahrzehnt reichenden Erfahrung auf diesem Gebiet lautet die Lieblingsfrage: »Ist das autobiographisch?«
In gemessenem Abstand folgen: »Woran schreiben Sie jetzt?«, »Verstehen Sie sich als politische Autorin?«, »Wie arbeiten Sie eigentlich? Wie Thomas Mann, jeden Tag zu festgesetzten Zeiten?« und – das ist eigentlich recht perfide – »Stört es Sie, daß man Sie so oft fragt, ob ein Text autobiographisch sei?«
Nachdem ich all dieses wieder und wieder nach Lesungen aus höchst unterschiedlichen Büchern mit einer meinem Arbeitsethos (wer zu meiner Lesung kommt, wird gut behandelt, auch nachdem er aus Sicht der Autorin verwirrend törichte Fragen gestellt hat) entsprechenden Geduld beantwortet habe, begann ich mich doch selber zu fragen: Warum so oft »Ist das autobiographisch«?
Bei näherem Hinsehen ist das eine äußerst komplizierte Frage. Das erste Moment, das einem natürlich dazu einfällt, ist das des allgegenwärtigen Voyeurismus. Man sehnt sich nach dem gläsernen Autor, das über das Buch gebeugte Gesicht scheint immer interessanter als das dort Beschriebene. Dieses Phänomen ist viel leichter durchschaubar als das der indirekten Geringschätzung der künstlerischen Leistung als solcher: denn je länger man sich »Ist das autobiographisch?« auf der Zunge zergehen läßt, desto mehr offenbart es eine Herabwürdigung des Autors und seiner Begabung: Gut ist, was authentisch ist; die künstlerische Leistung, sich etwas komplett auszudenken, zu fabulieren, scheint weniger wertvoll zu sein. Spinnen kann ja jeder. Danke sehr!
Der nächste Ansatz ist ein textimmanenter. Vielleicht scheinen meine Texte in ihrer, wie oft behauptet wird, »barocken Detailliebe«, ihrer überschwenglichen Begeisterung für alles Hör-, Riech- und Sichtbare so auf Spiegelung der Realität angelegt, daß der Gedanke des selbst Erlebten sich eher aufdrängt als bei Büchern anderer Autoren? Dem widerspricht jedoch, daß meine Protagonisten selten alter-ego-hafte Züge aufweisen, oft sind es Männer, Kinder oder alte Menschen. Wenn ich irgendwo selbst in Erscheinung getreten bin, dann als »Borddruckerassistentin Dückers« an der Reling der Gustloff (in »Himmelskörper«) oder als nervig-neugierige Schriftstellerin, die aus den Augen von Gefängnisinsassen gesehen wird (in »Café Brazil«) – eine Randfigur eben, keine zwei Absätze wert.
Der auf Textimmanenz abzielenden These widerspricht auch, daß zahlreiche Autoren, die zum Teil literarisch ganz anders arbeiten, Ähnliches über die derzeitige Konjunktur von »Ist das autobiographisch?« zu berichten wissen. Es handelt sich um ein gesellschaftliches Phänomen: genauer gesagt, um die seit Jahren anschwellende Begeisterung für alles Authentische. Ob Reality-Shows im Fernsehen, Lebensbeichten bei »Domian« oder Berichte über Bombenkrieg oder Flucht- und Vertreibungserlebnisse während des Zweiten Weltkriegs und danach. Authentizität scheint in einer Welt, in der man niemandem und nichts mehr trauen kann, eine höhere Weihe erhalten zu haben. Politiker haben im Vergleich zu früheren Jahrzehnten erheblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt, die Kirchen sowieso, große Dogmen erst recht. Was einem vermeintlich bleibt, ist das, was man am eigenen Leib erfährt: die Sinneseindrücke als letzte glaubwürdige Instanz. Das ist nicht das autonome, sondern das sensuelle Subjekt – sinnlicher Individualismus, Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-Sein pur. Als letzter Glaubensgarant bleibt der Körper. Welcher im Moment auch noch in besonderem Maße gefeiert wird – mittels all der biologistischen Thesen, sei es aus der Gender- oder der Altersforschung, die zur Zeit die Gazetten füllen. Das Wort der Dekade oder vielleicht sogar des Jahrhunderts? Die Gene. Die Heilstheorie der Gegenwart? Die Hirnforschung!
Das Uneindeutige, Vage, Versponnene, Erträumte, Halbreale, Fiktive: kurz das Künstlerische steht im Moment nicht gerade in seinem Zenit, auch wenn allerlei Mega-Spektakel von langen Museumsnächten über Marathonlesungen einem das Gegenteil vorzuspiegeln versuchen. In einer Ära, die die Liebe auf das Vorhandensein von Geruchsrezeptoren und das Leid auf Mangel an Hirnbotenstoffen zurückführt, Schicksal einzig mit Zufall und Vererbung zu erklären versucht und den Tod aus der Komplexität organischer Vorgänge heraus zur allgemeinen Verwirrung nicht mehr zu definieren weiß, kann etwas so Unerklärliches, geradezu anarchisch Subjektives wie Kunst nicht mehr für voll genommen werden. Was nicht heißt, daß derzeit keine relevante Kunst entsteht – es geht mir nicht darum, was für Kunst produziert wird, sondern wie sie wahrgenommen wird.
Romane müssen zunehmend journalistische Qualitäten aufweisen, »packend« und »dicht« sein, »spannend« wie ein Erlebnistrip, eine Reise. Ja, Reiseberichte sind zur Zeit besonders gefragt. Und Krimis lesen sich ohnehin am besten.
Gedichte hingegen werden seltsamerweise am wenigsten der Authentizität verdächtigt, wie ich beim Vortragen meiner Lyrik feststellen konnte. In der einzigen literarischen Gattung, bei der die Frage: »Ist das autobiographisch?« am ehrlichsten mit »ja« beantwortet werden könnte, wird diese Frage nie gestellt. Warum? Weil das selbst Erlebte meist nur noch dann »erkannt« wird, wenn es in einer bestimmten, tausendmal vorgeführten Gestalt und Form »dargeboten« wird.
Sind wir wirklich so weit gekommen, daß wir nur das für authentisch halten, was sich mimikryhaft als Realität gebärdet? Ist an der alten, langweiligen kulturpessimistischen Ansicht »Fernsehen verdirbt nicht nur die Augen« nicht doch etwas dran? Können wir uns in einer visuell überdominierten Welt innere Wahrheiten kaum mehr vorstellen? Waren die Impressionisten und die Abstrakten weiter als wir, weil sie Realität anders, eigener, wilder und subjektiver definierten als wir mit unserer »Tagesschau«-Vorstellung von Wahrheit?
Vielleicht. Denn mit der Frage »Ist das autobiographisch?« ist natürlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung verbunden. Nämlich – zu meinem Erstaunen – die Hoffnung, daß der Text eines Schriftstellers autobiographisch sei. Diese Hoffnung steht der des Autors diametral entgegen, der sich wünscht, die Realität zu überhöhen, transzendieren, statt plump tagebuchartig abzubilden. Der Motor des Schreibens: Die Sehnsucht nach diesem alchimistischen Prozeß, Erfahrung zu Kunst gerinnen zu lassen, zu verwandeln (ein kleines bißchen Zauberer sein zu wollen, wie Thomas Mann), die Erfahrung zu verfremden, ohne sie zu zerstören … den oft verschüttet-versteckten Nukleus einer Situation oder Konstellation vom Ballast und vom Beiwerk der »vollkommen realistischen Umstände« zu befreien und solitär zum Leuchten zu bringen …
Der Schriftsteller, jenseits des modern gewordenen Talk-Show-Teilnehmers, ist doch eher ein scheues Wesen, das sich das Aus-der-Realität-Flüchten zum Beruf gemacht hat, das schreibt, um die Realität – wenigstens auf dem Papier – zu verändern, nicht um sie zu repetieren. Daß sich Kunst heutzutage oft nur noch über den »Umweg Realität« legitimieren kann, zeugt von einem fatalen und fundamentalen Mißverständnis zwischen Künstler und Publikum. Und von einer Verwechselung von Schreiben-Können mit talentiertem Nacherzählen.
Früher galt eine naturalistische Abbildung der Realität als profan. Die mittelalterliche Malerei kannte nur den goldenen Bildhintergrund. Die Maler der florentinischen Renaissance revolutionierten das Kunstverständnis ihrer Zeit, als sie Portraithintergründe mit gewöhnlicher Flora und Fauna füllten und die Zentralperspektive als »irdisches Maß« in die Tafelmalerei einführten – Kunst wurde langsam von ihrer Aufgabe, religiöse Botschaften zu vermitteln, befreit und auf das menschliche Hier und Jetzt hin ausgerichtet. Doch das sich sehr langsam etablierende Genre der Landschaftsmalerei galt immer als ein wenig zweitklassig, und noch die ersten Fotografien wurden –Jahrhunderte später – skeptisch betrachtet.
Lange Zeit hatte die Kunst die zentrale Aufgabe, das darzustellen, was nicht sichtbar ist. Gott bzw. die Erfahrung Gottes, die Vorstellung vom Paradies sowie der Teufel und die Hölle wurden tausendfach auf Holztafeln und Leinwänden angerufen, beschworen, gebannt, verflucht; personalisiert durch irdische Vertreter, konturiert, ausgestaltet durch Landschaften, Licht und Dunkel. Viel später wurden – man denke zum Beispiel an Gauguin – geheimnisvolle innere Landschaften oder – wie bei den Abstrakten Expressionisten – seelische Abgründe, Brachen, fast nicht mehr von dieser Welt scheinende Verschmelzungssehnsüchte (Rothko) und unbewußte Energien (z. B. Pollock) erkundet.
Heute hat sich dieses Verhältnis geradezu umgedreht: Bildende Kunst und Literatur sind Sklaven des Sichtbaren, des Objektivierbaren und damit auch, wie in der Pop Art gefeiert, des Banalen geworden.
Bedeutet ein guter Roman denn heutzutage nur noch nacherzähltes Geschehen?
Ich bleibe dabei: Eine Frage wie »Wie Sie die Demenz der alten Frau aus Sicht einer Enkelin beschrieben haben, das ist wunderbar, ganz realistisch, haben Sie das selbst erlebt?« ist eigentlich eine viel größere Frechheit als »Sind Sie verheiratet?«